Nach Volkswagen und Mercedes hat nunmehr BMW seine Halbjahreszahlen verkündet. Auch bei den Bayern sieht es mit einem Rückgang von rund einem Drittel alles andere als rosig aus; aber stabiler als bei den deutschen Wettbewerbern. Doch wohin geht für die einst so erfolgsverwöhnten Firmen die Reise – wer leidet am meisten und wieso rutschen Erträge nebst Verkäufen bei vielen Konzernen aktuell so stark nach unten?
Geht es um die Gründe für die schlechten Wirtschaftszahlen, so werden zumeist drei Aspekte genannt: die schlechte Nachfrage in China, anhaltende Zollstreitigkeiten mit den Vereinigten Staaten und der allzu teure Umstieg auf die Elektromobilität. Alle drei Gründe haben eine nennenswerte Relevanz für die empfindlichen Rückgänge und doch ist es verwunderlich, dass gerade die sonst so ertragreichen Premiummarken wie Porsche, Audi und Mercedes derart abstürzen und auch BMW – bekannt für seine ausgewogene Finanzpolitik – derzeit derart unter Druck ist. Doch die Autoindustrie besteht nicht allein aus den OEMs. Bei vielen Autozulieferern sieht es noch deutlich schlechter aus und selbst die großen Firmen wie ZF, Bosch oder Continental kommen nicht aus den schlechten Schlagzeilen heraus.
China wird zum Problem
Über 15 Jahre konnte gerade die deutsche Autoindustrie in China das ganz große Geld verdienen. Auf dem wichtigsten Wachstums- und dem längst mit Abstand größten Automarkt der Welt geben mittlerweile jedoch in erster Linie die Heimspieler den Ton an. Geely, BYD, Saic, Nio, Li oder Great Wall – sie alle sind dort unterwegs, wo einst die deutschen Importfirmen mit ihren chinesischen Kooperationspartnern das große Geld scheffelten. Das ist nunmehr vorbei und dürfte nicht wiederkommen. Hier heißt es, auf die sich verändernde Nachfrage zu reagieren, Portfolios anzupassen oder Werke zu schließen, wie das VW bereits eingeleitet hat. Die Probleme mit Nordamerika und speziell der Zollpolitik unter US-Präsident Donald Trump sind eher ein temporäres Problem. Dabei bleibt die Frage offen, wie lange Donald Trump oder sein Nachfolger derart rigide durchregieren kann. Auf lange Sicht scheint der überbordende Protektionismus kaum aufrechtzuerhalten, wobei die Probleme nicht allein aus Washington kommen. Auch die EU mit Regierungssitz in Brüssel hat die Zollschranken für Produkte aus den USA seit Jahren heruntergelassen.
Das große Hoffen auf die E-Mobilität
Was das Gesamtklima verschärft: der Umstieg in die Elektromobilität kostet Milliarden – hunderte von Milliarden allein für die deutschen Konzerne und noch mehr Druck für die Zulieferbranche, die bereits vorher zu kämpfen hatte. Dass die Erträge bei den sich immer besser verkaufenden Elektroautos deutlich unter denen der Verbrenner liegen, ist dabei mindestens ein ebenso großes Problem wie die mäßige Akzeptanz speziell in Regionen wie Südeuropa, Südamerika oder den USA. Die Autohersteller müssen daher deutlich länger als ehemals geplant nicht nur international auf unterschiedlichen Hochzeiten tanzen, sondern parallel Antriebsarten wie Benziner / Diesel, Hybriden und Elektromodelle entwickeln sowie produzieren. Dazu kommen akute Währungsauswirkungen, die für Zulieferer und Autohersteller das Geschäft aktuell nennenswert negativ beeinflussen.
Zuviele Produktionsstätten und Arbeitnehmer?
Die größten Probleme der deutschen Marken liegen jedoch in den eigenen vier Wänden. Zu viele Fertigungsstätten mit oftmals mäßiger Auslastung, eine deutlich zu große Belegschaft, für die es nicht genug Arbeit gibt und die speziell in Deutschland, aber auch anderen europäischen Ländern, zu viel verdient, als dass sich die Autofirmen das erlauben könnten. Wirtschafts- und Branchenexperten wiesen seit vielen Jahren vergeblich darauf hin, dass die Zahl von Produktionsstätten und Arbeitnehmern spürbar nach unten angepasst werden muss, um fit für schlechte Zeiten zu sein. Genau solch ein Krise ist nun allgegenwärtig. BMW konnte seine Rückgänge nicht zuletzt deshalb in Grenzen halten, weil man nicht allein auf Elektroantriebe setzte und sich das größte Werk nicht in Deutschland, sondern im amerikanischen Spartanburg befindet.
Mercedes ist international aufgestellt
„In unserem größten Einzelwerk in Spartanburg, USA produzieren wir beispielsweise über 400.000 Fahrzeuge jährlich. Über die Hälfte davon ist für den lokalen Markt bestimmt, während die andere Hälfte exportiert wird“, so BMW-CEO Oliver Zipse, „in den Vereinigten Staaten haben wir eine umfangreiche Wertschöpfungskette sowie ein Kompetenzzentrum für unsere beliebten X Modelle in Spartanburg, die weltweit stark nachgefragt sind.“ Damit ist BMW seit vielen Jahren der größte Autoexporteur der USA. Auch Mercedes hat seit Jahren zwei seiner größten Werke in Tuscaloosa / USA und Peking / China für lokal für die dortigen Regionen ertragreich die Autos mit Stern gefertigt werden. Ob man auf lange Sicht neben dem Stammwerk in Sindelfingen und Untertürkheim die beiden Produktionen in Bremen und Rastatt braucht, erscheint zumindest fraglich.
So sieht es bei Volkswagen aus
Noch schwieriger sieht die Situation im Volkswagen Konzern aus. Markenableger Skoda ist mit strafferen Strukturen, einem fokussierten Portfolio und günstigeren Fertigungen im europäischen Ausland ebenso zufrieden die Seat. Volkswagen müsste dagegen allein Deutschland mindestens eines seiner größeren Werke schließen, weil die Nachfrage bei weitem nicht ausreicht. Doch selbst die Kleinstandorte in Osnabrück und Dresden sind unverändert geöffnet. Porsche und Audi haben trotz der großen Abhängigkeit vom nordamerikanischen Markt bisher keine Fertigung in den USA und die VW-Produktion in Chattanooga läuft auf Sparflamme. Das kann auch die Audi-Fertigung in San Jose Chiapa, wo der Q5 vom Band läuft, nicht ausgleichen. Das Gros der Modelle kommt aus Deutschland – das werden sich Audi und Porsche kaum länger erlauben können, um speziell in den USA als Gegenpol zum schwächelnden Chinageschäft erfolgreich zu sein. „Wir haben es weltweit weiterhin mit erheblichen Herausforderungen zu tun. Es ist kein Unwetter, das vorüberzieht. Die Welt verändert sich massiv – und vor allem anders als noch vor einigen Jahren erwartet. Einzelne strategische Entscheidungen von damals erscheinen heute in einem anderen Licht“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender von Porsche.
Was gilt es zu tun?
Was kann die deutsche Industrie daher tun, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden oder wurde alles verschlafen? An der deutschen Innovationskraft mangelt es ebenso wenig wie an dem Fortschritt bei den Elektroautos oder dem hoch automatisierten Fahren. Hier sind die deutschen Hersteller, allen voran die Premiummarken, weltweit in der ersten Reihe, auch wenn seitens der Batteriezellen die Abhängigkeit von China nicht auszulösen sein dürfte. Doch die Prozesse der deutschen Giganten sind zu komplex, die Entscheidungen zu langsam und die Kosten für Fertigung / Entwicklung bleiben trotz erster Dämpfungsmaßnahmen deutlich zu hoch. Hier drohen bis Mitte der 2030er Jahre harte Einschnitte. Bleibt die Frage, ob die großen Konzerne die Probleme und speziell die Kostenstrukturen in den kommenden Jahren in den Griff bekommen. Der Weltmarkt wird nicht auf Audi, VW, Porsche oder BMW warten, sondern fährt mit Vollgas – elektrisch oder mit Verbrenner – in die Zukunft. Bald auch autonom.










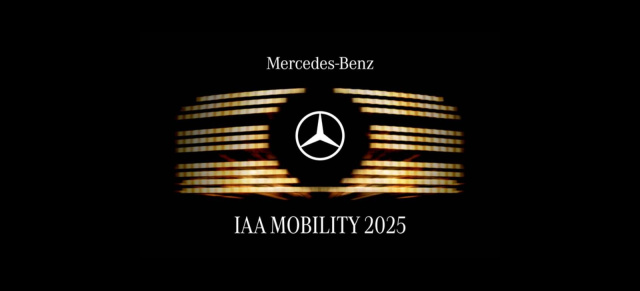
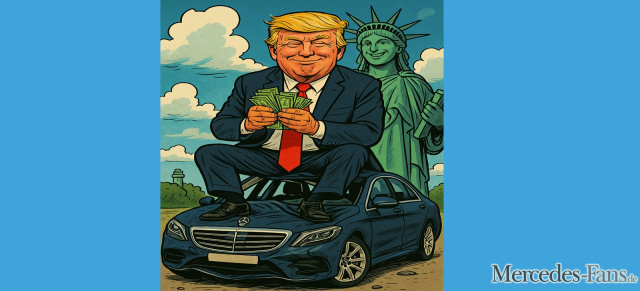



Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar